Wärmeleitung
Modellbildung
Ein zentrales Anliegen des Mathematik- und des Physikunterrichts ist die Modellbildung.
Besonders mächtige Modelle sind nach der Einführung der Infinitesimalrechnung möglich. So lange sollte man jedoch mit dem Thema Modellbildung nicht warten. Die folgende Idee bietet eine Möglichkeit, ohne den Ableitungsbegriff die Wärmeleitung zu behandeln, und dabei die Modellbildung mit mathematischen, physikalischen, numerischen und geologischen Überlegungen zu verbinden.
Eine gängige Methode der Modellbildung geht von "infinitesimalen" Betrachtungen an einem kleinen Intervall

aus. Durch Grenzübergang

gelangt man zu einer (gewöhlichen oder partiellen) Differentialgleichung. Bei der numerischen Analyse wird diese Differntialgleichung sodann wieder in der einen oder anderen Weise diskretisiert. Gelegentlich kann der Zwischenschritt aber übersprungen werden. Dadurch lässt sich direkt eine Differenzengleichung diskutieren und/oder implementieren:
Wir wollen dieses Vorgehen nun illustrieren und dabei die Diskussion der Wärmeleitung an den folgenden zwei miteinander verbundenen Fragen aufhängen:
Warum verbrennen wir uns nicht die Füsse an der Erdoberfläche?
Dies ist auf den ersten Blick eine seltsame Frage! Aber immerhin wird ein heisses Frühstücksei nach dem Abschrecken mit kaltem Wasser sehr schnell wieder von innen heraus heiss. Die Temperatur im Erdkern beträgt (je nach Quelle) rund 7000 K. Warum schmiltzt dann die Hitze aus dem Erdinnern im Lauf der Zeit die Erdkruste nicht komplett auf?

Wie alt ist die Welt?
Diese Frage stellte Lord Kelvin (William Thomson) 1862 im Zuge der Diskussion um die Evolutionstheorie. Darwins Gegner argumentierten, das durch die Bibel gegebene Alter der Erde von einigen Tausend Jahren sei viel zu gering, so dass die Evolution keine Zeit gehabt hätte überhaupt abzulaufen. Kelvin beabsichtigte durch eine physikalische Überlegung ein weit höheres Erdalter zu etablieren um so das Argument von Darwins Gegnern zu entkräften.
- Kelvins Idee: Betrachte die Erde als abkühlenden Körper und berechne aus den Daten die Abkühldauer. Newtons Abkühlungsgesetz lässt sich zwar nicht direkt auf den Planeten Erde übertragen, aber wir werden weiter unten sehen, wie Kelvin im Prinzip vorgegangen ist.
- Kelvins Resultat: 24 bis 400 Millionen Jahre.
- Heute geschätztes Erdalter: 4.5 Milliarden Jahre.
Warum hat sich Lord Kelvin so verschätzt? Was Kelvin noch nicht wissen konnte: Im Erdinnern wird Wärme erzeugt durch
- natürliche Radioaktivität (von Becquerel erst 1896 entdeckt)
- Auskristallisieren des Erdkerns
- Gezeitenkräfte (die resultierende Reibung erzeugt Wärme, wie beim Kneten eines Brotteigs)
Durch diese Effekte verlängert sich der Abkühlvorgang. Solange die erwähnten "inneren" Wärmequellen nicht versiegen wird die Erde auch nicht vollständig auskühlen sondern einem thermischen Gleichgewicht zustreben. Wir kommen darauf zurück.
Nun werden wir anhand einiger einfacher Überlegungen zu einem Modell der Wärme gelangen.
Modell der Wärme
Für das folgende ist es nicht nötig einen Begriff von kinetischer Wärmetheorie aufzubauen. Es genügen heuristische Beobachtungen, die durch Experimente illustriert und untermauert werden können. Wir stellen uns vor, dass Wärme eine Energieform ist, welche der Materie innewohnt und sich durch deren Temperatur manifestiert.
Legt man sein heisses Frühstücksei in einen kleinen Topf mit kaltem Wasser, so stellt man fest, dass sich das Ei abkühlt und das Wasser leicht erwärmt, solange bis sich die Tempratur ausgeglichen hat. Der umgekehrte Vorgang, dass nämlich ein Ei dem umgebenden Wasser Wärme entzieht und spontan heiss wird, kommt nicht vor. Das ist der Inhalt des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik.
Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik und Wärmeleitung
Eine Version dieses Satzes besagt:
| Zweiter Hauptsatz der Wärmelehre |
| Wärme fliesst selbständig nur von einem Körper höherer zu einem Körper niedrigerer Temperatur. |
Der zweite Hauptsatz zeigt also die Richung des Wärmeflusses an. 1822 formulierte Joseph Fourier eine quantitative Fassung der Wärmeleitung in seiner
Théorie analytique de la chaleur:

Fourier argumentierte, dass die Wärmemenge

, die in der Zeit

von rechts nach links durch das Wandstück fliesst, proportional ist zu

, zur Fläche

und zur Temperaturdifferenz

. So fliesst etwa durch ein doppelt so grosses Flächenstück doppelt so viel Wärme. Andererseits isoliert eine dickere Wand besser als eine dünne, das heisst

ist umgekehrt proportional zu Dicke

. In Formeln liest sich das so:
| Wärmeleitungsgesetz |
Die Wärmemenge  , die in der Zeit , die in der Zeit  von rechts nach links durch das Wandstück fliesst, ist von rechts nach links durch das Wandstück fliesst, ist

Dabei bezeichnet  die Wärmeleitfähigkeit des Materials. die Wärmeleitfähigkeit des Materials. |
Wärmekapazität
Die Zufuhr von Wärme erhöht die Temperatur eines Körpers (sofern nicht gerade ein Phasenübergang stattfindet):

Dies lässt sich zum Beispiel erreichen, indem man den Körper in Kontakt mit einem wärmeren Körper bringt, oder indem man die Wärme durch mechanische Reibung zuführt: Reibt man die Hände aneinander werden sie warm. Reibt man länger (leistet also mehr mechanische Arbeit), werden sie wärmer:
Je mehr Wärme zufliesst, desto grösser wird die Temperaturerhöhung ausfallen. Andererseits braucht man bei doppelter Masse auch doppelt so viel Wärmeenergie für die selbe Temperaturerhöhung. Quantitativ lässt sich diese Aussage wie folgt fassen:
| Wärmekapazität |
Fliesst die Wämemenge  in eine Masse in eine Masse  hinein, erhöht sich deren Temperatur um hinein, erhöht sich deren Temperatur um

Dabei bezeichnet  die spezifische Wärmekapazität des Materials. die spezifische Wärmekapazität des Materials. |
Heizleistung
Die Heizleistung (etwa durch Radioaktivität im Erdinnern) ist definiert als die erzeugte Wärmemenge pro Masseneinheit und pro Zeiteinheit:

Als Formel notiert ergibt sich:
| Heizleistung |
Im Zeitintervall  werde in einem Massenstück werde in einem Massenstück  die Wärmemenge die Wärmemenge  erzeugt. Dann ist die Heizleistung erzeugt. Dann ist die Heizleistung
 |
Mit diesem Rüstzeug sind wir nun in der Lage, den zeitlichen Verlauf einer Temperaturverteilung zu modelliern.
Wärmeleitung im Stab
Frage: Wie entwickelt sich die Temperaturverteilung in einem Stab im Laufe der Zeit?
Für die Buchhaltung nehmen wir zunächst die Daten des Stabes auf:
- Länge

- Querschnittsfläche

- Dichte

- Wärmeleitfähigkeit

- Wärmekapazität

- Heizleistung

Die Idee besteht darin, Messpunkte im Abstand

zu betrachten. An den einzelnen Messpunkten greifen wir die Temperatur

zur Zeit

ab:

Es ist naheliegend nicht nur den Ort, sondern auch die Zeit zu diskretisieren, d.h. wir interessieren uns nur noch für die Zeitpunkte

. Auf diese Weise erhalten wir ein Gitter.
Auf der horizontalen x-Achse nimmt der Stab das Intervall
![$[0,L]$](/pub/PAM/Waermeleitung/latexe0669427b7dd85d91bb11f391e449cf9.png)
ein, nach oben tragen wir die Zeit

ab:

Mit
Tij bezeichnen wir dabei die Temperatur am Ort
x = i Δx zur Zeit
t = j Δt.
Betrachten wir im Detail den Wärmefluss am rot schraffierten Abschnitt des Stabes im Zeitintervall
![$[j\Delta t,(j+1)\Delta t]$](/pub/PAM/Waermeleitung/latex16e13758d2e34319f0bddc771b44080c.png)
und berechnen den Wärmefluss mit Hilfe des Gesetzes von Fourier sowie die lokal erzeugte Wärme:

| Von rechts hinein: |  |
| Nach links hinaus: |  |
| Lokal erzeugt: |  |
Das rot schraffierte Massenstück

erlebt also im Zeitraum

total die Wärmezunahme

.
Gemäss dem Gesetz der Wärmekapazität führt dieser Nettowärmezufluss zu einer entsprechenden Zunahme (oder Abnahme falls die Bilanz negativ ist) der Temperatur des Massenstücks:
Setzen wir die Terme linkerhand ein und formen um, so lautet diese Beziehung:
Dies ist die
diskrete Wärmeleitungsgleichung in einer Raumdimension. Im Limes

,

ergibt sich daraus die "richtige" Wärmeleitungsgleichung, eine partielle Differentialgleichung.
Durch Auflösen nach

ergibt sich ein numerisches Rechenschema, das sogenannte Richardson Verfahren:

Gibt man folgendes vor
- Anfangstemperaturverteilung

- Randtemperatur links

- Randtemperatur rechts

so lässt sich zeilenweise von unten beginnend die Temperatur in jedem Gitterpunkt berechnen:

Das Resultat zeigt die Wärmeentwicklung bei konstanter Heizleistung im Stab im Laufe der Zeit:
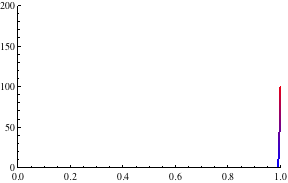
Als Beobachtung halten wir fest:
- Die Lösung konvergiert gegen eine stationäre Verteilung
- Die stationäre Verteilung scheint die Form einer Parabel zu haben (dies wird sich später bestätigen)
- Spielt man im beigefügten Mathematica-Programm mit den Parametern, so zeigt sich, dass
 im Vergleich zu
im Vergleich zu  klein genug sein muss, damit das Richardson-Verfahren numerisch stabil ist. Es muss näich die Courant-Friedrich-Levy Bedingung gelten:
klein genug sein muss, damit das Richardson-Verfahren numerisch stabil ist. Es muss näich die Courant-Friedrich-Levy Bedingung gelten: 
Wärmeleitung in einer quadratischen Platte
Der Schritt von einem eindimensionalen Stab zu einer zweidimensionalen Platte ist einfach. Wir diskretisieren die Platte:

Randbedingung für  | Anfangsbedingungen |
|---|
Am roten Rand: 
Am blauen Rand:  |  zur Zeit zur Zeit  |
Stellen wir die Wärmebilanz für das rot schraffierte Quadrat auf

so erhalten wir
Dies ist die zweidimensionale Wärmeleitungsgleichung.
Für

erhalten wir im stationären Fall:
Das heisst, im zentralen Punkt

ist die Temperatur das arithmetische Mittel der
Nachbarpunkte in Norden, Süden, Osten und Westen.
Diese Gleichung muss in jedem inneren Gitterpunkt

gelten. Man hat also ebensoviele Gleichungen wie Unbekannte.
| Diskrete harmonische Funktionen |
| Die Temperatur in einem Gitterpunkt ist das arithmetische Mittel seiner Nachbarpunkte. Lösungen dieses linearen Systems heissen diskrete harmonische Funktionen. |
Aus der Mittelwerteigenschaft folgt sofort:
| Diskretes Maximumprinzip |
| Nimmt eine diskrete harmonische Funktione in einem inneren Punkt ihr Maximum an, so ist sie konstant. |
Wendet man das diskrete Maximumprinzip auf die Differenz zweier
Lösungen an, so bekommt man
| Eindeutigkeit |
| Es existiert hochstens eine diskrete harmonische Funktion mit gegebenen Randwerten. |
Und die lineare Algebra liefert daraus gratis hinzu:
| Existenz |
| Zu beliebig vorgegebenen Randwerten existiert eine diskrete harmonische Funktion. |
Für

und

kann man das entstehende Gleichungssystem
noch von Hand lösen. Fur grosse

ist selbst ein Computer mit
Gauss-Elimination überfordert.
Als Ausweg bieten sich zwei Methoden an:
- Gauss-Seidel Iteration
- Monte-Carlo Verfahren
Randbedingungen
Am Rand eines Gebietes können wir vorschreiben:
- die Temperatur in jedem Punkt (Dirichlet-Randbedingung)
- den Wärmefluss (Neumann-Randbedingung)
Die Neumann-Bedingung ist für unsere Ausgangsfrage wichtig, denn auf der Erdoberfläche finden wir die drei im Folgenden beschriebenen Effekte.
Sonneneinstrahlung

Solarkonstante
 Achtung:
Achtung: Die vom Querschnitt der Erde aufgefangene Leistung wird auf die ganze Kugeloberfläche verteilt:

Die effektive Solarkonstante reduziert sich somit auf einen Viertel des Wertes:

Albedo-Effekt

Rund 31% der Sonneneinstrahlung wird wieder in den Weltraum zurückgeworfen. Die von der Sonne eingefangene Strahlungsleistung reduziert sich also auf den Wert

mit

.
Thermische Abstrahlung

| Stefan-Bolzmann Strahlungsgesetz |
Ein schwarzer Strahler der Temperatur  strahlt von einem Flächenstück strahlt von einem Flächenstück  seiner Oberfläche die Leistung seiner Oberfläche die Leistung  ab. Dabei ist ab. Dabei ist  . . |
Bei einem realen Strahler reduziert sich die Emission um den Faktor

. Nach dem Kirchhoffschen Strahlungsgesetz ist dieser Emissiongrad gleich dem Absorptionsgrad, für die Erde also

.
Der eindimensionale Planet

Die eindimensionale Wärmeleitungsgleichung liefert:
Die zweite Differenzenfolge ist konstant, somit lautet die Lösung
Offenbar ist

und aus Symmetriegründen ist

:
Setzen wir noch

so erhalten wir
Das ist sogar die
exakte Lösung der dahinterstehenden Differentialgleichung.
Insbesondere gilt
Dies erklärt qualitativ unsere Ausgangsfrage!
Wir denken uns nun den Stab als Bohrkern durch die Erde mit entsprechenden Strahlungseffekten an den Stirnflächen: Die gesamte Heizleistung des Stabes ist gleich der an den beiden Stirnseiten des Stabes netto abgestrahlten Leistung. Also
-
 mittlerer Erdradius
mittlerer Erdradius  m
m
-
 mittlere Erddichte
mittlere Erddichte 
-
 Albedowert der Erde
Albedowert der Erde 
-

-

-
 mittlere Wärmeleitfähigkeit Erde (Granit)
mittlere Wärmeleitfähigkeit Erde (Granit) 
-
 Mittlere Erdtemperatur
Mittlere Erdtemperatur  K
K
Aus (2) erhält man

Aus (1) bekommt man dann

K (unrealistisch!)
Der dreidimensionale Planet
Wir betrachten dünne Kugelschalen:

Fluss durch  nach innen: nach innen: |  |
Fluss durch  nach innen: nach innen: |  |
| Heizleistung dazwischen: |  |
Die Bilanz ergibt:
Lassen wir quadratische Terme

weg, so ergibt sich
Der Ansatz

liefert

.
Somit
Setzen wir noch

so erhalten wir
Die Strahlenbilanz an der Oberfäche der Kugel mit Radius

ergibt die Randbedingung
Aus (3) und (4) erhält man durch Elimination von

Für eine Kerntemperatur

K und Erddaten wie zuvor erhält man
eine Oberflächentemperatur

von etwas über

K
und damit dann

.
Fragen, die man nun diskutieren kann
- Diskutiere Unterschiede zwischen Planet und Modell
% Konvektion, inhomogene Schichtung, Erdrotation,
% Atmosphaere
- Berechne in (3)
 , also den
, also den
Temperaturgradienten an der Erdoberfläche (Erdwärmenutzung)
- Berechne in (4) die Ableitung von
 nach
nach  ,
,
also die Änderung der Gleichgewichtstemperatur bei
Änderung der Albedo-Konstanten (Klimawandel)
- Jupitermond Europa: Wie tief unter dem Eis liegt der (vermutete) Wasserozean?
% NASA: 50 km
http://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/0,1518,535523,00.html
 aus. Durch Grenzübergang
aus. Durch Grenzübergang  gelangt man zu einer (gewöhlichen oder partiellen) Differentialgleichung. Bei der numerischen Analyse wird diese Differntialgleichung sodann wieder in der einen oder anderen Weise diskretisiert. Gelegentlich kann der Zwischenschritt aber übersprungen werden. Dadurch lässt sich direkt eine Differenzengleichung diskutieren und/oder implementieren:
gelangt man zu einer (gewöhlichen oder partiellen) Differentialgleichung. Bei der numerischen Analyse wird diese Differntialgleichung sodann wieder in der einen oder anderen Weise diskretisiert. Gelegentlich kann der Zwischenschritt aber übersprungen werden. Dadurch lässt sich direkt eine Differenzengleichung diskutieren und/oder implementieren:


 Fourier argumentierte, dass die Wärmemenge
Fourier argumentierte, dass die Wärmemenge  , die in der Zeit
, die in der Zeit  von rechts nach links durch das Wandstück fliesst, proportional ist zu
von rechts nach links durch das Wandstück fliesst, proportional ist zu  , zur Fläche
, zur Fläche  und zur Temperaturdifferenz
und zur Temperaturdifferenz  . So fliesst etwa durch ein doppelt so grosses Flächenstück doppelt so viel Wärme. Andererseits isoliert eine dickere Wand besser als eine dünne, das heisst
. So fliesst etwa durch ein doppelt so grosses Flächenstück doppelt so viel Wärme. Andererseits isoliert eine dickere Wand besser als eine dünne, das heisst  ist umgekehrt proportional zu Dicke
ist umgekehrt proportional zu Dicke  . In Formeln liest sich das so:
. In Formeln liest sich das so: , die in der Zeit
, die in der Zeit  von rechts nach links durch das Wandstück fliesst, ist
von rechts nach links durch das Wandstück fliesst, ist 
 die Wärmeleitfähigkeit des Materials.
die Wärmeleitfähigkeit des Materials. 
 in eine Masse
in eine Masse  hinein, erhöht sich deren Temperatur um
hinein, erhöht sich deren Temperatur um 
 die spezifische Wärmekapazität des Materials.
die spezifische Wärmekapazität des Materials. 
 werde in einem Massenstück
werde in einem Massenstück  die Wärmemenge
die Wärmemenge  erzeugt. Dann ist die Heizleistung
erzeugt. Dann ist die Heizleistung 






 zu betrachten. An den einzelnen Messpunkten greifen wir die Temperatur
zu betrachten. An den einzelnen Messpunkten greifen wir die Temperatur  zur Zeit
zur Zeit  ab:
ab:

 . Auf diese Weise erhalten wir ein Gitter.
Auf der horizontalen x-Achse nimmt der Stab das Intervall
. Auf diese Weise erhalten wir ein Gitter.
Auf der horizontalen x-Achse nimmt der Stab das Intervall ![$[0,L]$](/pub/PAM/Waermeleitung/latexe0669427b7dd85d91bb11f391e449cf9.png) ein, nach oben tragen wir die Zeit
ein, nach oben tragen wir die Zeit  ab:
ab:

![$[j\Delta t,(j+1)\Delta t]$](/pub/PAM/Waermeleitung/latex16e13758d2e34319f0bddc771b44080c.png) und berechnen den Wärmefluss mit Hilfe des Gesetzes von Fourier sowie die lokal erzeugte Wärme:
und berechnen den Wärmefluss mit Hilfe des Gesetzes von Fourier sowie die lokal erzeugte Wärme:




 erlebt also im Zeitraum
erlebt also im Zeitraum  total die Wärmezunahme
total die Wärmezunahme  .
Gemäss dem Gesetz der Wärmekapazität führt dieser Nettowärmezufluss zu einer entsprechenden Zunahme (oder Abnahme falls die Bilanz negativ ist) der Temperatur des Massenstücks:
.
Gemäss dem Gesetz der Wärmekapazität führt dieser Nettowärmezufluss zu einer entsprechenden Zunahme (oder Abnahme falls die Bilanz negativ ist) der Temperatur des Massenstücks:
![\[ \Delta Q_{\rm{in}} + \Delta Q_{\rm{loc}}-\Delta Q_{\rm{out}} = A\,\Delta x \, \rho\,c\,(T_{ij+1}-T_{ij}) \]](/pub/PAM/Waermeleitung/latex2f81066ec6ded9e44009d008444a8c09.png)
![\[ \frac{\lambda}{\rho c}\frac{T_{i+1j}-2T_{ij} +T_{i-1j}}{\Delta x^2} +\frac fc = \frac{T_{ij+1}-T_{ij}}{\Delta t} \]](/pub/PAM/Waermeleitung/latexc4cdd91819b2bd5bb7be63678fb2f5af.png)
 ,
,  ergibt sich daraus die "richtige" Wärmeleitungsgleichung, eine partielle Differentialgleichung.
Durch Auflösen nach
ergibt sich daraus die "richtige" Wärmeleitungsgleichung, eine partielle Differentialgleichung.
Durch Auflösen nach  ergibt sich ein numerisches Rechenschema, das sogenannte Richardson Verfahren:
ergibt sich ein numerisches Rechenschema, das sogenannte Richardson Verfahren:
 Gibt man folgendes vor
Gibt man folgendes vor



 Das Resultat zeigt die Wärmeentwicklung bei konstanter Heizleistung im Stab im Laufe der Zeit:
Das Resultat zeigt die Wärmeentwicklung bei konstanter Heizleistung im Stab im Laufe der Zeit:
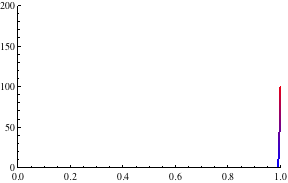 Als Beobachtung halten wir fest:
Als Beobachtung halten wir fest:
 im Vergleich zu
im Vergleich zu  klein genug sein muss, damit das Richardson-Verfahren numerisch stabil ist. Es muss näich die Courant-Friedrich-Levy Bedingung gelten:
klein genug sein muss, damit das Richardson-Verfahren numerisch stabil ist. Es muss näich die Courant-Friedrich-Levy Bedingung gelten: 




 zur Zeit
zur Zeit 
 so erhalten wir
so erhalten wir
![\[ \frac{\lambda}{\rho c} \frac{T_O(t)+T_N(t)+T_W(t)+T_S(t)-4T_Z(t)}{\Delta x^2}+\frac fc =\frac{T_Z(t+ \Delta t)- T_Z(t)}{\Delta t} \]](/pub/PAM/Waermeleitung/latex2c31f66e2f9eb4bd1276f1458aa4cf93.png)
 erhalten wir im stationären Fall:
erhalten wir im stationären Fall:
![\[ T_Z =\frac14(T_O+T_N+T_W+T_S) \]](/pub/PAM/Waermeleitung/latex50557302e974ba9d6ff26c37b0670832.png)
 ist die Temperatur das arithmetische Mittel der
Nachbarpunkte in Norden, Süden, Osten und Westen.
Diese Gleichung muss in jedem inneren Gitterpunkt
ist die Temperatur das arithmetische Mittel der
Nachbarpunkte in Norden, Süden, Osten und Westen.
Diese Gleichung muss in jedem inneren Gitterpunkt  gelten. Man hat also ebensoviele Gleichungen wie Unbekannte.
gelten. Man hat also ebensoviele Gleichungen wie Unbekannte.
 und
und  kann man das entstehende Gleichungssystem
noch von Hand lösen. Fur grosse
kann man das entstehende Gleichungssystem
noch von Hand lösen. Fur grosse  ist selbst ein Computer mit
Gauss-Elimination überfordert.
Als Ausweg bieten sich zwei Methoden an:
ist selbst ein Computer mit
Gauss-Elimination überfordert.
Als Ausweg bieten sich zwei Methoden an:
 Solarkonstante
Solarkonstante  Achtung: Die vom Querschnitt der Erde aufgefangene Leistung wird auf die ganze Kugeloberfläche verteilt:
Achtung: Die vom Querschnitt der Erde aufgefangene Leistung wird auf die ganze Kugeloberfläche verteilt:
 Die effektive Solarkonstante reduziert sich somit auf einen Viertel des Wertes:
Die effektive Solarkonstante reduziert sich somit auf einen Viertel des Wertes: 
 Rund 31% der Sonneneinstrahlung wird wieder in den Weltraum zurückgeworfen. Die von der Sonne eingefangene Strahlungsleistung reduziert sich also auf den Wert
Rund 31% der Sonneneinstrahlung wird wieder in den Weltraum zurückgeworfen. Die von der Sonne eingefangene Strahlungsleistung reduziert sich also auf den Wert  mit
mit  .
.

 strahlt von einem Flächenstück
strahlt von einem Flächenstück  seiner Oberfläche die Leistung
seiner Oberfläche die Leistung  ab. Dabei ist
ab. Dabei ist  .
.  . Nach dem Kirchhoffschen Strahlungsgesetz ist dieser Emissiongrad gleich dem Absorptionsgrad, für die Erde also
. Nach dem Kirchhoffschen Strahlungsgesetz ist dieser Emissiongrad gleich dem Absorptionsgrad, für die Erde also  .
.
 Die eindimensionale Wärmeleitungsgleichung liefert:
Die eindimensionale Wärmeleitungsgleichung liefert:
![\[ T_{i+1}-2T_i+T_{i-1}= -\frac{f\rho\,\Delta x^2}{\lambda} \]](/pub/PAM/Waermeleitung/latex10898de500da52685a1999b97611fa36.png)
![\[ T_i=-\frac{f\rho\,\Delta x^2}{2\lambda} i^2+bi+c \]](/pub/PAM/Waermeleitung/latex0fc963e3cffd2d160c775f4dffef23ae.png)
 und aus Symmetriegründen ist
und aus Symmetriegründen ist  :
:
![\[ T_i=-\frac{f\rho(i\Delta x)^2}{2\lambda}+T_0 \]](/pub/PAM/Waermeleitung/latexd498e689238eab8ebc1df204edce6a14.png)
 so erhalten wir
so erhalten wir
![\[ T(x)=T(0)-\frac{f\rho}{2\lambda} x^2 \]](/pub/PAM/Waermeleitung/latex75b7b3a567168f0073f152a272f9550c.png)


 mittlerer Erdradius
mittlerer Erdradius  m
m
 mittlere Erddichte
mittlere Erddichte 
 Albedowert der Erde
Albedowert der Erde 


 mittlere Wärmeleitfähigkeit Erde (Granit)
mittlere Wärmeleitfähigkeit Erde (Granit) 
 Mittlere Erdtemperatur
Mittlere Erdtemperatur  K
K
 Aus (1) bekommt man dann
Aus (1) bekommt man dann  K (unrealistisch!)
K (unrealistisch!)

 nach innen:
nach innen:
 nach innen:
nach innen: 

![\[ \frac{ (1+\frac1{2i})^2T_{i+1} - (2+\frac1{2i^2})T_i + (1-\frac1{2i})^2T_{i-1} }{ \Delta x^2 }= -\frac{f\rho}{\lambda} \]](/pub/PAM/Waermeleitung/latex52ef5ccd14ab5c70284191b382d27977.png)
 weg, so ergibt sich
weg, so ergibt sich
![\[ (1+\frac1i)T_{i+1} -2 T_i +(1-\frac1i)T_{i-1}= -\frac{f\rho\Delta x^2}{\lambda} \]](/pub/PAM/Waermeleitung/latex43999d8e29d6da50dd658a688374e5c4.png)
 liefert
liefert  .
Somit
.
Somit
![\[ T_i=-\frac{f\rho\Delta x^2}{6\lambda} i^2+T_0 \]](/pub/PAM/Waermeleitung/latex6cf2606e893752d6ecf1fc67f08bd779.png)
 so erhalten wir
so erhalten wir


![\[ f\frac43\pi R^3\rho = 4\pi R^2(\sigma T_R^4(1-a) -\bar\Sigma(1-a)) \]](/pub/PAM/Waermeleitung/latex9a501f752d96a5e8f0d185cdd48e4fe8.png)


![\[ T(R)=T_0-\frac{R(1-a)(\sigma T(R)^4-\bar\Sigma)}{2\lambda} \]](/pub/PAM/Waermeleitung/latex63b1e3d4acdeb4a9a1a20689294fe50b.png)
 K und Erddaten wie zuvor erhält man
eine Oberflächentemperatur
K und Erddaten wie zuvor erhält man
eine Oberflächentemperatur  von etwas über
von etwas über  K
und damit dann
K
und damit dann  .
.
 , also den
, also den
 nach
nach  ,
,

